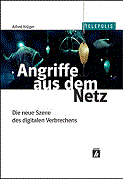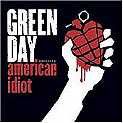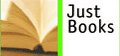Bundesrat fordert verschärfte Überwachung
Bundestrojaner nicht vom Tisch
Der Bundestrojaner, also jenes Schnüffelprogramm, das die verdeckte Online-Durchsuchung privater Rechner ermöglichen soll, ist längst noch nicht vom Tisch. Der Bundesrat lehnte heute zwar entsprechende Forderungen einiger Bundesländer wie etwa Bayern ab, die verdeckte Online-Durchsuchung im Zusammenhang mit der Neuregung der Telekommunikationsüberwachung gleich mit zu regeln. Die Bundesratsmehrheit entschied sich allerdings dafür, erst einmal einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung abzuwarten. Das Bundesinnenministerium arbeitet längst an diesem Entwurf. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hat eine Gesetzesvorlage noch vor dem Sommer angekündigt.
Keine verlängerte Speicherfrist
Der Innen- und der Rechtsausschuss des Bundesrates hatten in ihrem umfangreichen Empfehlungskatalog unter anderem die Ausweitung der Speicherfristen bei der Datenspeicherung auf Vorrat gefordert. Sämtliche Verbindungsdaten, die bei der Kommunikation via Telefon, Handy, Internet und Email anfallen, sollten nach dem Willen der Ausschüsse ein ganzes Jahr lang auf Vorrat, also für den Bedarfsfall gespeichert werden. Der Regierungsentwurf sieht „nur“ eine Frist von sechs Monaten vor. Die Bundesratsmehrheit mochte den Ausschüssen nicht folgen und lehnte die Fristverlängerung mehrheitlich ab.
Begehrlichkeiten sind geweckt
In vielen anderen Punkten geht der Regierungsentwurf dem Bundesrat allerdings noch nicht weit genug. So soll der Katalog der Straftaten, die die Ermittlungsbehörden zum Abhören von Telefon und Emails ermächtigen, ausgeweitet werden. Auch bei schweren Verstößen gegen das Vereins- und das Grundstoffüberwachungsgesetz solle künftig abgehört werden dürfen. Forderungen wie diese belegen, dass allein schon die Möglichkeit des Abhörens und das Vorhandensein von Nutzerdaten weitere Begehrlichkeiten wecken. Es scheint das Motto zu gelten: Wir haben die Daten, also müssen wir sie auch möglichst umfassend nutzen. Dass dieses Motto mit den Freiheitsrechten der Bürger kollidieren könnte, sieht die Mehrheit des Bundesrates offenbar nicht. Ein Grundrecht auf „Internetfreiheit“ zieht sie noch nicht einmal ansatzweise in Betracht.
Zivilrechtliches Auskunftsrecht
Demgegenüber hat die Mehrheit der Ländervertreter für die „berechtigten“ Belange der Inhaber von Urheberrechten offenbar stets ein offenes Ohr. Die Forderung, dass beispielsweise die Musikindustrie und ihre Anwälte auf die auf Vorrat gespeicherten Datenberge zugreifen dürfen, um zivilrechtlich etwa gegen Tauschbörsennutzer vorzugehen, erschien der Bundesratsmehrheit absolut plausibel. Ansonsten würde das im Telemediengesetz vorgesehene Auskunftsrecht gegenüber Internetprovidern leer laufen, wurde argumentiert. Auch hier gilt: Wenn die Daten nun schon einmal erhoben und gespeichert sind, muss man auf sie auch zugreifen dürfen. Dass damit das Prinzip ad absurdum geführt wird, die Daten nur zur Aufklärung schwerster Straftaten (Terrorismus, organisierte Kriminalität) zu verwenden, ist der Bundesratsmehrheit offenbar völlig egal.
„Kernbereich der privaten Lebensgestaltung“
Die Mehrheit des Bundesrats stößt sich darüber hinaus an der Forderung des Bundesverfassungsgerichts, dass bei allen Abhör- und Überwachungsmaßnahmen der so genannte „Kernbereich der privaten Lebensgestaltung“ nicht berührt werden dürfe. Das sei praktisch nicht umsetzbar, heißt es. Bei der Überwachung fielen naturgemäß auch Daten an, die das Bundesverfassungsgericht für besonders schützenswert hält. Es gebe keine Filtersoftware, die derart Privates von anderen Inhalten trennen könne. Der Bundesrat hat deshalb die Bundesregierung aufgefordert, zu dieser Problematik Stellung zu beziehen.
Zurück zur News-Übersicht