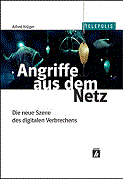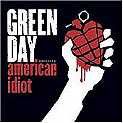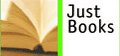Kehrtwende im Datenschutz
Schwarz-roter Richtungswechsel im Datenschutz
In der Bundesrepublik sollen künftig sämtliche Telefon- und Internetverbindungsdaten für einen Zeitraum von sechs Monaten gespeichert werden. Die Bundestagsmehrheit, bestehend aus den Stimmen der Großen Koalition, vollzog mit dieser Entscheidung einen grundsätzlichen Richtungswandel. Noch zu Zeiten der rot-grünen Regierung hatte sich der Bundestag gegen die verdachtsunabhängige Datenspeicherung auf Vorrat ausgesprochen. Die Argumente, die damals auf den Tisch des Hohen Hauses kamen, zählen jetzt offenbar nicht mehr. Die EU fordert die Umsetzung ihrer Richtlinie, und die schwarz-rote Koalition möchte diese Forderung vorbehaltlos erfüllen. Dass dabei nur die von der EU-Richtlinie vorgesehenen „Mindestanforderungen“ hinsichtlich der Zeitdauer der Speicherung umgesetzt werden sollen, wertet die Koalition als eine Entscheidung „mit Augenmaß“. Dass sie hinsichtlich der Frage, wann Ermittlungsbehörden auf die gespeicherten Daten zugreifen dürfen, keinesfalls am unteren Limit bleibt, fällt nicht mehr unter „Augenmaß“, sondern wird mit der Notwendigkeit einer effektiven Verbrechensbekämpfung begründet – letztlich fadenscheinige Argumente, deren empirische Begründung immer noch aussteht.
Der Bürger zahlt seine Überwachung selbst
Für die FDP-Bundestagsfraktion sprach die Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger von einer „maßlosen“ Maßnahme, bei der überhaupt nicht erwiesen sei, dass sie für eine wirksamere Verbrechensbekämpfung überhaupt nötig sei. Leutheusser-Schnarrenberger, die dem linksliberalen Flügel er FDP zuzuordnen ist, führte aus, dass es mit den gespeicherten Kommunikationsdaten künftig möglich werde, über Monate hinweg exakt und in allen Einzelheiten nachzuvollziehen, wer im Internet wann welche Seiten aufgerufen und wer mit wem telefoniert habe. Diese Datenspeicherung erfolge unabhängig davon, ob konkrete Verdachtsmomente im Einzelfall vorliegen. Und wer bezahlt den immensen Aufwand, der zur lückenlosen Vorratsdatenspeicherung betrieben werden muss? Auch darauf hatte Leutheusser-Schnarrenberger eine passende Antwort: Der einzelne Bürger müsse letztlich für die eigene Überwachung zahlen – sei es über die von ihm gezahlten Steuern oder durch erhöhte Gebühren an die Internetprovider.
Das Damoklesschwert der Überwachung
Auch Linkspartei und Grüne sparten nicht mit Kritik an der Position der schwarz-roten Bundestagsmehrheit. Die Linkspartei befürchtete, dass die Bürger künftig nicht mehr vorbehaltsfrei kommunizieren könnten, weil über jedem Telefongespräch und jeder Surftour im Netz das Damoklesschwert der Überwachung schwebe. Die Grünen argumentierten auf einer ähnlichen Schiene. Hier hieß es, dass man aus den erfassten Verbindungsdaten durchaus Rückschlüsse auf soziales Verhalten, Interessen und Inhalte der Kommunikation ziehen könne. Die geplante Vorratsdatenspeicherung greife tief in die grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte des einzelnen Bürgers ein. Das sei bisher auch die Mehrheitsmeinung im Bundestag gewesen. Jetzt aber werde eine datenschutzrechtliche Kehrtwende eingeleitet – zu Lasten der Bürger.
Datenspeicherung im Interesse der Musikindustrie
Auch Bundesdatenschützer Peter Schaar übte an der nunmehr vollzogenen Kurskorrektur in Sachen Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz scharfe Kritik. Schaar hatte sich bereits früher vehement gegen eine verdachtsunabhängige Datenspeicherung auf Vorrat ausgesprochen und wiederholte seine grundsätzlichen Bedenken gegen die Regierungspläne. Zwar bleibe die Bundestagsmehrheit hinsichtlich der Speicherdauer am unteren Ende des geforderten zeitlichen Rahmens. Die Kommunikationsdaten sollen „nur“ für sechs Monate gespeichert werden. Doch befürchtet Schaar, „dass diese Daten nicht nur für die Aufklärung schwerer Verbrechen genutzt werden. So fordert die Musikindustrie bereits seit längerem den Zugang zu Verkehrsdaten von Teilnehmern der Tauschbörsen im Internet.“ Es dürfe nicht passieren, dass die Zwecke, die dem Staat den Zugriff auf die gespeicherten Daten erlauben, Schritt für Schritt ausgeweitet würden, so Schaar weiter. „Es darf nicht so weit kommen, dass jeder Mausklick oder jeder Abruf von Inhalten aus dem Internet protokolliert wird.“
Zurück zur News-Übersicht