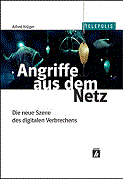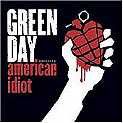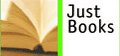Niederlage für den Datenschutz
Substanzielles Bedürfnis
Richter Ware hat es sich nicht leicht gemacht. Auf 21 Seiten begründet er seine offizielle Entscheidung, die Google nunmehr zwingt, 50.000 Webadressen aus seinem URL-Fundus herauszugeben und dem US-Justizministerium für statistische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Das Ministerium habe sein „substanzielles Bedürfnis“ nach diesen Daten hinreichend begründen können, meint der Richter. Private Nutzungsdaten muss die Suchmaschinenfirma nicht herausrücken. Auch wenn die Bush-Regierung nur anonyme Datensätze gefordert habe, müsse man bedenken, dass Google durch die Herausgabe von Suchanfragen in der Öffentlichkeit in einem ungünstigen Licht erscheinen könne. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Staat die Suchanfragen quasi mitlese. Google-Nutzer sollen sicher sein, dass niemand ihre Suchanfragen mitschneidet – niemand außer Google selbst.
Munition aus Googles Webindex
Die Bush-Regierung will Googles Datensätze benutzen, um per statistischer Analyse nachzuweisen, dass Minderjährige auch bei der Eingabe an sich harmloser Suchbegriffe auf pornografische Inhalte im Web stoßen könnten. Diese Analyse soll in einem Gerichtsverfahren benutzt werden, in dem es um die Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit des Child Online Protection Act (COPA) geht. Der COPA soll es kommerziellen Webseitenbetreibern verbieten, pornografisches Material frei verfügbar ins Netz zu stellen, ist aber so weit gefasst, dass auch andere Inhalte betroffen sein könnten. Die traditionsreiche American Civil Liberties Union(ACLU) hatte erfolgreich gegen dieses Gesetz geklagt. Googles Daten sollen der Bush-Regierung nun genug Munition liefern, um den COPA doch noch vor der Versenkung zu bewahren.
0,000625 Prozent
Es bleibt zu fragen, was man mit nur 50.000 zufällig aus dem Google-Webindex ausgewählten Webseiten überhaupt beweisen kann. Der gelernte Statistiker würde realistischerweise sagen: „Nichts!“ Google hortet rund 8 Milliarden Webseiten in seinem Index. Die geforderten 50.000 Webseiten machen also nur 0.000625 Prozent des gesamten Google-Webindex aus. Demzufolge ist die geforderte Webseitenstichprobe viel zu klein, um eine wenigstens halbwegs gesicherte statistische Aussage über die Verteilung pornografischer Webseiten im Google-Index treffen zu können. Selbst ausgeklügelte statistische Methoden können daran nichts ändern. Wenn die Stichprobe im Verhältnis zur Grundgesamtheit zu klein ist, lassen sich keine repräsentativen Aussagen mehr treffen. Noch nicht einmal Trends wären ablesbar. Der Faktor „Zufall“ wäre viel zu groß.
Demonstration von Macht
Warum also diese Aufregung? Warum legte es das US-Justizministerium auf einen öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit mit der kalifornischen Suchmaschinenfirma an? Es steht zu vermuten, dass es der Bush-Regierung im jetzigen Verfahren überhaupt nicht um Googles konkrete Daten geht. Denn die 50.000 Webadressen hätte man sich ohne Einschaltung eines Gerichts auch aus dem frei zugänglichen Index der Suchmaschinenfirma beschaffen können. Offenbar geht es dem US-Justizministerium darum, seine Macht zu demonstrieren und den großen Internetfirmen zu zeigen, dass man sich jederzeit Zugriff auf deren Datenbestände verschaffen könne – ganz legal über einen gerichtlichen Herausgabeanspruch, wie fadenscheinig der auch begründet sein mag. Diesmal ging es „nur“ um anonyme Nutzungsdaten und zufällig ausgewählte Webadressen. Das nächste Mal könnte es beispielsweise um lokal begrenzte Suchanfragen gehen – etwa wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens geht. Suchmaschinen wie Google könnten dann etwa gezwungen werden, im „Interesse der Sicherheit des Staates und des Allgemeinwohls“ alle Suchanfragen von Nutzern herauszugeben, die beispielsweise in Dallas/Texas leben.
Ein Meilenstein auf dem Weg zum Überwachungsstaat
Die jetzt gefällt Entscheidung mag auf den ersten Blick wie ein Sieg für den Datenschutz erscheinen. Personenbezogene Suchanfragen müssen nicht herausgegeben werden und wurden nie gefordert. Doch diese Einschätzung täuscht. Richter Ware hatte nicht den Datenschutz der Google-Nutzer im Hinterkopf, sondern das „berechtigte Interesse“ der Suchmaschinenfirma daran, dass ihre Nutzer „unkontrolliert“ suchen können sollen. Alles andere wäre geschäftsschädigend gewesen. Richter Wares Entscheidung ist also alles andere als ein Sieg des Datenschutzes über das Schnüffelinteresse des Staates. Die Entscheidung ist im Gegenteil ein Meilenstein… auf dem Weg zum omnipotenten Überwachungsstaat.
Zurück zur News-Übersicht